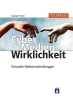|
|
|
Zu den Aporien moralischer Reflexion Paradiesischer Anfang: Der freie Wille, der Gott so angelegen ist, lässt das Böse zu. Das Böse als Nichtkategorie, als substanzloses Nichts belegt in seiner divinen Rückversicherung die Unwilligkeit, das Böse zu erfassen, ihm einen Platz und originäre Qualität zuzusprechen. Dafür, dass das Böse nach Augustinus so substanzlos ist, hat es allerdings einen sehr soliden Wirklichkeitsstatus, wenn wir uns erst einmal auf die Unterscheidung eingelassen haben. Das Böse als Derivat des Guten, nicht als manichäische Gegenmacht, könnte jedoch mehr sein als der Stoff, aus dem man Theodizeen macht, wenn er zugleich eine unhintergehbare logische Kontur hätte. Wie sieht der logische Test aus: Könnte das Abhängigkeitsverhältnis moralischer Werte umgekehrt formuliert werden? Erst kommt das Böse, das Gute wäre dagegen nur seine Ableitung. Wir können zwar traditionell oder mit psychoanalytischer Unterstützung behaupten, dass das Böse ein fehlgeleitetes Gutes ist. Dagegen aber das Gute als akzidentiell zum Bösen zu denken, das Böse also als vorrangiges Prinzip zu formulieren, macht vorderhand wenig Sinn. Hier hilft allerdings die Denkfigur Friedrich Nietzsches, das Gute als eine moralische (!) Schwäche zu behandeln, böse zu sein. Hier werden die Rollen der moralischen Bewertungen von menschlichen Handlungen vertauscht, sodass also cum grano salis das Gute das Böse wäre wie umgekehrt. Nietzsche demonstrierte diese Umwertung der Werte durch einen Tigersprung zurück in die vorsokratische Epoche, vor den Beginn des christlichen Platonismus. Nun sollte eine entmuckerte, ästhetisch sich aufgipfelnde Existenz das Dasein neu rechtfertigen und vitalisieren. Sein Angebot, diese postchristliche Wertefabrikation gleich selbst zu besorgen, ließ ihn in höchster Weise von sich selbst denken, zur Zäsur der Zeitalter werden: »Plato hat es prachtvoll beschrieben, wie der philosophische Denker inmitten jeder bestehenden Gesellschaft als der Ausbund aller Ruchlosigkeit gelten muss: denn als Kritiker aller Sitten ist er der Gegensatz des sittlichen Menschen, und wenn er es nicht so weit bringt, der Gesetzgeber neuer Sitten zu werden, so bleibt er in der Erinnerung der Menschen zurück als 'das böse Prinzip'.« (Friedrich Nietzsche, Morgenröte). In das »Jenseits von Gut und Böse« gelangen wir dadurch heute längst nicht, weil wir uns nicht nur – wenn auch unter anderen Vorzeichen – in die älteste Moralunterscheidung verstricken, sondern die ästhetische Lebensform eine durch und durch vitalistische Fiktion ist, die sich in den Anmutungen der verwalteten Existenz auflöst oder lächerlich (Stefan George) wird. Niklas Luhmann provozierte in selbstreferentieller Anwendung der moralischen Reflexion auf ihre Unterscheidung hin mit der radikaleren Frage, ob es gut sei, den Unterschied von Gut und Böse zu machen. Ist es nicht ein Fehltritt, sich für das Gute zu entscheiden, wenn allein eine moralfreie Beobachtung wissenschaftlich probat wäre? Doch dann ist es gut, sich als Wissenschaftler bei der Untersuchung des Guten, nicht für das Gute zu unterscheiden. Dieser paradoxe Zirkel markiert weiterhin, dass es offensichtlich schwierig bis unmöglich ist, in unserem moralischen Apriori zu formulieren, dass es böse ist, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Wenn wir die Unterscheidung auf sich selbst anwenden, entsteht wiederum eine neue moralische Ordnung, in der es gut wäre, nicht moralisch zu urteilen. Fazit ist also, dass in systemtheoretischer Perspektive die zuvor so selbstgewisse Ethik die Moral nicht grundieren kann, sondern kontingent bleibt. Als gesellschaftliche Supercodierung wird das Schema »Gut/Böse« zwar permanent instrumentalisiert, wie es der politische Apparat in seiner »höheren Amoralität« zeigt. Tatsächlich folgen aber – und dafür muss man kein Systemtheoretiker sein – gesellschaftliche Teilbereiche, vulgo: Systeme, völlig anderen Imperativen, was nicht ausschließt, dass die Moral, assistiert von anderen Codes, plötzlich und unerwartet zuschlägt (Beispiel: Karl-Theodor zu Guttenberg). Immerhin kann uns der ewige Ge- und Missbrauch der moralischen Differenzierung dahin führen, die Unterscheidung für nicht gut zu halten, wenigstens aber für bedeutungslos, wenn wir nicht ihren reflexionslogischen Kontext genauer angeben. Wer moralisiert, will verletzen, heißt es bei Niklas Luhmann, was wiederum nietzscheanisch übersetzt heißt: Wer moralisiert, strebt nach Macht. Der Systemtheoretiker rät daher zu einer Ethik, die vor der Moral warnt. Aber ist das nicht wieder der Beelzebub, der den Teufel austreibt? Es macht offensichtlich auch ethisch wenig Sinn, gutes und böses Handeln als inkommensurabel zu bezeichnen, weil die moralische Differenzierung auf das Miteinander beide Werte, auf die Einheit der Differenz angewiesen bleibt. Eine moralische Reflexion, die beide Prinzipien beziehungslos nebeneinander verwenden wollte, wäre ein aporetisches Unternehmen, weil sie keine Aussagen mehr über richtiges Verhalten treffen könnte. Wer das Böse radikalisiert und autonom werden lässt, begibt sich der Kritik. Insofern sind die verhandelten Modelle unzulänglich, sodass jenseits der naiven, aber praktikablen Unterscheidung, »gut« und »böse« zu fragilen Kategorien werden. Die moralische Reflexion der Moral setzt einer Vernunft, die doch praktisch sein will, erheblich zu, ohne dass noch der Glaube bestünde, sich hier aus einer rein strategischen Option für diese oder jene Differenzierung zweier moralischer Zustände noch befreien zu können. Gegenüber manichäischen Wiederbelebungen oder axiomatischen Ontologisierungen des Bösen ist es also vorzugswürdig, die Referenzen des Wertschemas genauer anzugeben. Folgenbetrachtungen von Handlungen sind »moralisch« wichtiger als generelle Standortbestimmungen eines abstrakt Guten/Bösen. Was passiert, wenn ich dieses oder jenes tue, wäre dann eine kategorische Frage, ohne die Antwort in einem vorgeschalteten Imperativ zu suchen, den alle (pflichtgemäß) Handelnden gegenzeichnen. Insofern besitzt die moralische Reflexion selbst eine moralische Qualität, ohne der Aufdringlichkeit einer machtorientierten Ethik verfallen zu müssen, trennscharfe Unterschiede zwischen »gut« und »böse« zu verordnen. »Da die Urteilskraft auf Andere reflektiert, ist nur der ‚böse’ Mensch, der nicht urteilt, den Unterschied nicht kennt, zu allem fähig.« Hannah Arendt formuliert hier den intellektuellen Glauben, dass das Denken selbst nicht böse sein kann. Nur der, der nicht denkt, sei böse. Wir gelangen hier auf dem Weg der politischen Urteilskraft zu einer kommunikativen Vernunft, die schon im Apriori »gut« ist, weil Kommunikation in ihren Geltungsansprüchen darin besteht, den Anderen anzuerkennen. Goedart Palm |
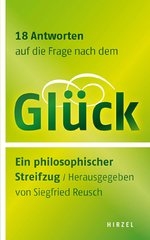
Goedart Palm, Glück und Faulheit, S. 61 ff. in: 18 Antworten auf die Frage nach dem Glück Ein philosophischer Streifzug - hrsg. von Siegfried Reusch (Autoren: Rüdiger Safranski, Annemarie Pieper, Pascal Bruckner u.a.) 2011. Buch. 232 S. Paperback
|