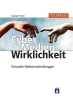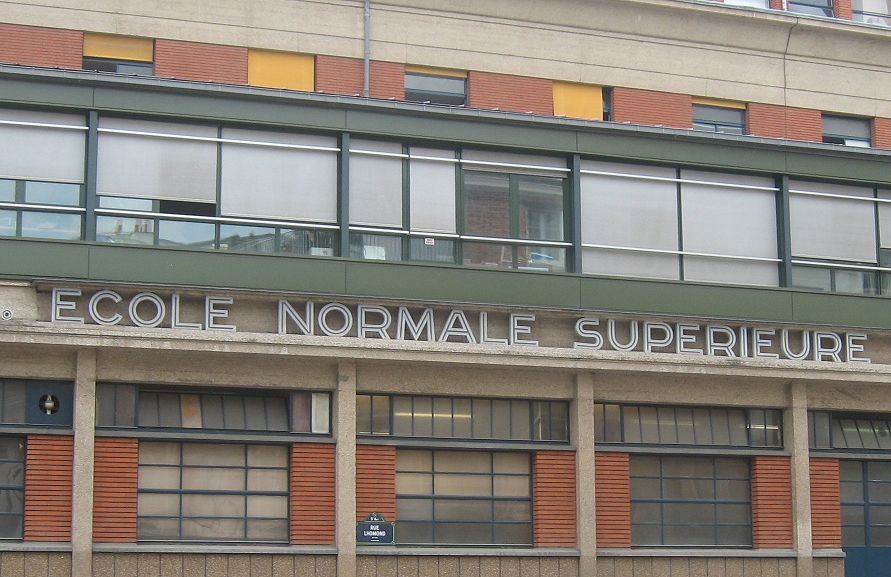|
|
Medien
Philosophen, Theoretiker, Wissenschaftler, Popularisten, Quacksalber
| Hier geht es nur um ein paar unangestrengte Bemerkungen zu eigenen Lektüreerfahrungen zum Thema "Medientheoretiker" und Lektüre. Der folgende Text ist "in progress", sodass mir ja keiner vorwerfen möge, was ich gestern gesagt - und morgen noch nicht gesagt habe. Vermutlich ist Medientheorie ein Irrtum, weil das Gegenstandsfeld so wenig statisch ist, dass jede Theorie Gefahr läuft, mit kürzesten Halbwertszeiten obsolet zu werden. Ohnehin bedeutet Theorie, Wirklichkeit so zusammenzufassen, dass eine mögliche Praxis mit ihr verbunden sein könnte. Hat je eine Medientheorie Medienmanifestationen maßgeblich geprägt? Wurden mediale Ereignisse nur per Theorie möglich oder hechelte die Medientheorie einigen Phänomenen nach, die sich bei näherem Zusehen als wenig willfährige Medienobjekte erwiesen? Theorie ist ein Handwerkszeug, mehr nicht. Wenn das consensus omnium wäre, wären wir ein großes Stück weiter. Für Theorie heißt das wie für jede "engine": Entweder sie funktioniert oder sie tut es nicht. Zwar mögen falsche Theorien richtige Theorien fördern und solche Umwege muss man akzeptieren so wie sieben Brücken oder sieben Fässer Wein. Doch eine Theorie, die selbstreferentiell bleibt, genießt sehr schnell einen Einsamkeitsstatus, der ihre - neudeutsch gesprochen - Anschlussfähigkeit beeinträchtigt. Medientheorie, so wie sie heute praktiziert respektive gelehrt wird, ist ein müßiges Geschäft, das für hoffnungsvolle Karrieren eher nicht mehr in Betracht kommt. |
| Bazon Brock - Kleiner FB-Eintrag in anderem Zusammenhang: Kein geringer Teil jener wunderwollen Welterklärungstexte unerreichbarer Bescheidwisser, die Suhrkamp vornehmlich in den siebziger Jahre produzierte, haben den höchsten Anspruch, als Satire wiederentdeckt zu werden. Brock hatte das vielleicht früh erkannt und immer ein wenig den Clown der fröhlichen Wissenschaft gegeben, was seine Ernsthaftigkeit eher belegt als beschädigt. |
| Daniel J. Boorstin - Die Schrift über das "Image" ist eine vorzügliche Darstellung wesentlicher Themen der Medienkritik. Boorstin präsentiert auch viele Leitmotive, die später von anderen fortgeführt wurden, ohne sich an diese Referenz erinnern zu wollen. Das Buch hat auch den Charme jener Tage, ohne deswegen an Aktualität zu verlieren. |
| Immanuel Kant - Der vielleicht wichtigste Text zur Medientheorie bleibt die "Kritik der reinen Vernunft", weil Immanuel Kant hier die Erkenntnisbildung im Bewusstsein als medialen Vorgang schildert. Er steigt aus ontischen Sümpfen auf, das vormals Reale wird nun zur Erkenntnisfrage. "Die modi cogitandi entpuppen sich als modi essendi" (Otfried Höffe). Übrigens ist die Realität keine Frage des Seins, sondern der positiven Eigenschaften der Sache, was in Zeiten der Virtualität praktisch wird. Unnötiger Ballast des Wirklichkeitsbegriffs wird abgeworfen und wir starten als selbstbezügliche Medien durch. Der transzendentale Zugriff auf die Welt ist die höchste Virtualität, die sich für Menschen einstellen kann, weil es hier um die Bedingungen möglicher Erfahrung geht. Ließe sich das transzendentale Programm selbst virtuell abbilden, müssten alle möglichen Erfahrungen erscheinen. Das wäre dann das Ende der Welt, weil nichts mehr vor uns läge, was noch zu erfahren wäre. |
| Novalis |
| Friedrich Schlegel |
| Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Wenn also Hegel nach Adorno nur assoziativ gelesen werden kann, was kaum bezweifelt werden kann, so leiten diese Texte eine neue Art der Lektüre ein, die das philosophische Denken in der Folge immer stärker erfasst. |
| Friedrich Nietzsche |
| Marshall McLuhan hat in den "Magischen Kanälen" klar gemacht, dass man über Medien völlig anders schreiben kann, als das zuvor möglich erschien. Medien sind Protagonisten, Stars der Szene, die folglich auch theoretisch inszeniert werden wollen. McLuhan hat ein sinnliches Verhältnis zu Medien. Erfinder und womöglich der Vollender der Medienwissenschaft - so wenig das für die Branche akzeptabel wäre. |
| Friedrich A. Kittler ist wohl als der große alte Mann der bundesrepublikanischen Medientheorie zu bezeichnen. "Grammophon Film Typewriter" ist größtenteils gut lesbar, wenngleich für Friedrich A. Kittler immer gilt, dass die Verschaltung von Text und Technik, also die Vorführung seines eigenen Paradigmas im Text, mitunter zur Unlesbarkeit führt. Es gibt kryptische Passagen, deren Widerstand gegen Lektüre, die zentrale Aussage sein könnte. Die "technischen Schriften" müssten mal überarbeitet werden. Kittler wird man im Zweifel selektiv lesen, "Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft" ist von dieser Feststellung ausnehmen. |
| Paul Virilio schaltet Tempo und Apokalypse kurz und daher ist der Text selbst auch kurzweilig. Die Struktur dieser Erkenntnis ist allerdings weniger originell, als es das Feuilleton uns weiland glauben machen wollte. Dass alles schließlich still steht, wenn es nur dynamisch genug ist, folgt einer alten Dialektik. Nur, wir erleben nach wie vor keinen rasenden Stillstand und Virilio möchte die Verlangsamungen wohl auch nicht sehen. Mentalitätsumbauten werden auch nicht in´s Auge gefasst, die etwa einen Teil der Last als Ballast behandeln oder auf virtuelle Helfer vertrauen. "Geschwindigkeit" allein ist kein ausreichendes Medienparadigma. Weder den Wahrheitsanspruch noch die neuen Gesten kann man in eine Temporalstruktur auflösen, wie es V. mitunter zu gelingen scheint und uns nur als Mimesis an den Schrecken erscheint. |
| Vilem Flusser schreibt McLuhan fort. Seine Zukunftsauffassungen sind wie die von McLuhan nicht allzu spannend. Wichtiger sind die Feststellungen zum Ende der alphabetischen Kultur und zum Verständnis von "Techno-Bildern". Auf der Grundlage von "Gesten: Versuch einer Phänomenologie" könnte man gut über die Gefahr einer Nichtfixbarkeit von Gesten im Gebrauch "neuer" Medien nachdenken. |
| Hartmut Winkler "Docuverse" eher schwer zu lesen. |
| Jochen Hörisch hat keine eigene Medientheorie verfasst, ist aber ein äußerst kurzweiliger Autor mit einem gut sortierten Hintergrundwissen. Leidet vielleicht unter einem Vielschreibersyndrom, was aber keine Kritik sein muss. Manchmal "macht er den Kittler", was bis in die Formulierungen hinein nachweisbar ist. Im Gegensatz zu Kittler ist er aber stärker den Sinnlichkeiten der Lektüre verpflichtet und kein "Techno-Freak" wie jener. "Eine Geschichte der Medien" ist natürlich Pflichtlektüre. |
| Rainer Leschke - Die "Einführung in die Medienethik" überzeugt mich nicht, weil der erste Teil, die Ethik-Grundierung, sehr kontingent ausfällt und der Hauptteil einige metaethische Aussagen macht, die nicht falsch sein mögen, aber längst nicht ausreichen, deutlich zu machen, ob diesem Untersuchungsgegenstand irgendeine besondere Relevanz zukommt, von Regeln, die etwa Medienverhalten originell bestimmen könnten, ganz zu schweigen. Metaethik wird so zur Flucht vor dem Thema, das vielleicht wirklich keines mehr ist. Denn bereits die Ethik (welche?) ist eine schwer belastete Disziplin, die nun in einem fluktuierenden Feld mit zahlreichen ethischen wie moralischen Ansprüchen in noch größere Konfusionen gestürzt wird. |
| Mike Sandbothe |
| Frank Schirrmacher - Payback. Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Meine Einschätzung: Der Titel sagt alles, wirklich alles. Die gute alte Manipulationsthese im alten Beschwörungsgestus. Das ist Lichtjahre von dem entfernt, was ich denken möchte. Kontrolle über mein Denken heißt hier, diese Schrift nicht über das hinaus zur Kenntnis zu nehmen, was die Spatzen von den Dächern (viele zu Recht) über diese opus trällern. Zitat Detlef Hartlap: "...der Oberhysteriker der deutschen Publizistik und Bestseller-Autor (was zusammenhängt)." Das trifft es. |
| Fortsetzung folgt (wie fast immer). |
|
|