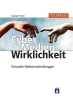|
|
Roland Barthes
|
Die Vorbereitung der
Rezension zur Vorbereitung des Romans Wie soll ich nur anfangen?
Vorrede, Vorspiel, Vorwort. Gewiss: Hinter dem Horizont geht es vermutlich
weiter, aber zuerst müssen horror vacui, Antriebslosigkeit und
Banalisierungslüste überwunden werden. Schreibhaltungen, wie wir sie großen
Autoren unterstellen, werden in unserer Click-and-find-Logik instantaner
Darstellungen immer unplausibler. Die mehr oder minder wilden Sprünge der
You-Tube-Generation durch den eigenen kulturellen Ramschladen bescheren
keine literarischen Geländegewinne. Wenn schon diese Lebenswelten so
formlos sind und zum digitalen Patchwork verkümmern, wie soll dann die
Hoffnung begründet werden, dass sich Schreiblüste noch zu einem großen
Roman, einem unsterblichen Epos oder einem Gedicht von erhabener
Verbindlichkeit vervollkommnen? Die Verfertigung der Gedanken beim
Schwadronieren ist ungleich einfacher als diese Prozedur beim Schreiben,
zumal mit digitalen Schreibprogrammen, die nun endlose Korrekturen,
Repetitionen, Versionen eröffnen, ohne dass es noch legitim erscheint,
zum Schluss zu kommen. Wie entstanden weiland große Werke? Roland Barthes
schreibt in seinem letzten Werk solchen Schreibhaltungen nach: „Die
Vorbereitung des Romans“ handelt zuvörderst von der existenziellen
Paradoxie des Schriftstellers, einerseits zum bedingungslosen Schreiben
getrieben zu sein und andererseits mit großer Angst davor zurückzuschrecken.
Obsession, Begehren und Angst treiben den Schriftsteller zu mitunter
unglaublichen Veranstaltungen und Vorkehrungen, die unwahrscheinliche
Produktion gegen alle Widerstände möglich zu machen, mit einem Wort: der
Schriftsteller setzt sein Leben daran respektive verschenkt es, wenn er
nur produktiv im emphatischen Sinne werden kann. Die fundamentale Unruhe
des zum Schreiben Verurteilten ruft nach der Methode. Wo schreibe ich? Mit
welchem Material? Welchen Gesetzen gehorcht die Proxemie des
Schreibtischs? Friedrich Nietzsche wurde hier zum Spätberufenen dieser diätetischen,
ergo-nomischen Fragen, die etwa durch Wanderungen gelöst wurden, die
seine Schrift unleserlich machten, aber den begehrten „Flash“
bescherten. Anderen Schreibhaltungen misstraute der Professor in Sils
Maria. Selbst die Tischdecke auf seinem Schreibtisch musste bestimmten
Farben und Mustern folgen, um seinen permanenten Kopfschmerz zu lindern.
Wie werde ich also der, der ich sein könnte, muss auch und gerade im
Blick auf scheinbar triviale Umstände beantwortet werden? So wie Pelikan
den perfekten Schulfüller für folgsame Kinderhände entwirft, braucht es
auch später komplexe Konditionen des Geräts, der Haltung, der Räume
etc., wenn der geniale Schreibakt gelingen soll. Diese
Produktionsbedingungen umtreiben viele Autoren im Sog des Schreibens und
Schreibenwollens und sind oft als Erklärung für individuelles Scheitern
geeignet. Man kann bekanntlich Bleistifte „tot“ spitzen, was eine schöne
Metapher für das Elend der Präliminarien ist. Roland Barthes wollte
nicht nur spitzen, sondern einen veritablen Roman schreiben, es blieb
jedoch bei der Vorbereitung, genauer gesagt: bei einer Vorlesungsreihe am
Collège de France. Oder ist die Vorbereitung gerade das, was wirklich
wichtig ist? Jeder Künstler, nicht nur der Schriftsteller, kennt dieses
Problem, abstrakt schaffen zu wollen, aber nicht zum konkreten Werk zu
gelangen. Schreiben ja, aber Figuren und Dramen entwickeln, wenn der Modus
des Schreibens „an und für sich“ so erhaben und unbefleckt vom
Schicksal ist. Die Wege sind so verschieden wie unwegsam (de periculis
contingentibus) gebaut, dass Roland Barthes viele Vorbereitungen trifft,
um die „Vorbereitungen“ zu beschreiben. Dieser Schriftsteller schreibt
in einem Rausch, einige Stunden später sind ewige Werke fertig, jener
schreibt sich die „Finger wund“, ohne dass die fertige Textgestalt je
erscheinen will. Kafka schrieb das „Urteil“ in einigen nächtlichen
Stunden vom 22. zum 23. September 1912, die als euphorischer Zustand
erfahren werden und vielleicht als Geburtsstunde eines Schriftgottes
gelten können. Diese divine Berufung musste indes dem Beruf abgerungen
werden. Das Büro raubt dir die Lebenszeit und man kann dieses Elend, für
das Überleben zu arbeiten, allenfalls dadurch ein wenig kompensieren,
dass man aus Rache noch besser schreibt. Für Franz Kafka ist der Kampf
gegen die Fremdbestimmung und zu Gunsten seines Werks ähnlich wie das,
was wir heute „waterboarding“ nennen: „…es handelt sich nur darum,
solange es geht, den Kopf hoch zu halten, dass ich nicht ertrinke.“
Musil schrieb und schrieb und schrieb, was immerhin die Paradoxie
milderte, die Roland Barthes markiert: Das Schreiben ist ein ewiger
Selbstbetrug, denn immer will man fertig werden, um dann sofort wieder mit
dieser quälenden Kondition des Unfertigen und des erneut einsetzenden
Nervenkriegs gegenüber den Zumutungen des Werks zu beginnen.
Wenn
wir die „Vorbereitung des Romans“ als das Dilemma der semiologischen
Methode selbst nehmen, können wir auch in dieser Annäherung an den
schriftstellerischen Produktionsprozess erkennen, dass wir immer nur auf
Zeichen von etwas stoßen, nicht aber auf dieses „Etwas“ selbst. Dabei
geht es nicht darum, das „Ding an sich“ oder das „Genie“
transzendental wiederzubeleben, sondern wir müssten auf Beschreibungen
stoßen, die nicht in dem semiologischen Verweisungsdreieck verschwinden.
Annäherungen, Umkreisungen, Berührungen des begehrten Objekts erklärt
uns die Semiologie, aber längst nicht die kreativen Akte selbst, selbst
nicht Roland Barthes, so empfindsam und erfindungsreich er als Herr im
pluralen Reich seiner Zeichen auch ist. Seine „Vorbereitung“ ist die
Geschichte eines relativen Scheiterns, weil der Leser viel über die
Konditionen der Literatur erfährt und auch das Scheitern nur eine Frage
der Perspektive ist, aber eine Wahrheit sich als Fazit der finalen
Vorbereitung aufdrängt: Ein Roman ist ein Roman ist ein Roman... Goedart Palm Roland Barthes - Die
Vorbereitung des Romans Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a.M. 2008 ISBN-10 351812529X ISBN-13 9783518125298 Taschenbuch, 550
Seiten, 18,00 EUR
Delacroix Digitale Kunst Festspielhaus art numerique Florian Schneider Halluzinogen
|